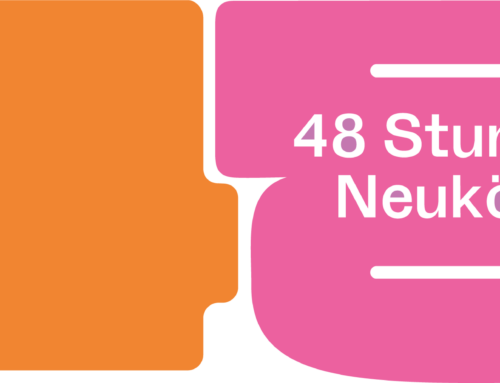Julia Pankratyeva, Gabriele Weber und Klara Gibert, eine Aussiedlerin und langjährige Besucherin des Interkulturellen Treffpunkts, Foto und Interview: Michaela Kirschning
Am 16. Mai bin ich mit der Projektleiterin von ImPULS e.V., Julia Pankratyeva, im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt verabredet.
Auf der Website des Vereins heißt es:
ImPULS e.V. wurde im März 2005 in der Neuköllner Gropiusstadt gegründet. Der Verein dient als Plattform für Integrationsarbeit in diesem Stadtteil und darüber hinaus. (…) Schon vor der offiziellen Gründung als Verein haben wir, gefördert vom Kulturamt Neukölln, im Jahr 1997 das erste Projekt für Aussiedler begonnen, gefolgt von MannOMann (für Männer mit technischer Ausbildung), gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Es ist ein schöner Zufall, dass auch „die Frau der ersten Stunde“ und mehrjährige Mitstreiterin, Gabriele Weber, anwesend ist und kurzentschlossen führen wir das Gespräch zu dritt, nachdem wir uns zuvor zusammen die Ausstellung anlässlich des 25-jährigen Jubiläums angeschaut haben. Die Fotos dokumentieren eine Vielzahl gemeinsamer Aktivitäten und Veranstaltungen und wecken bei meinen Gesprächspartnerinnen Erinnerungen an eine bewegte Geschichte. Ich möchte mehr darüber erfahren, wie es zur Gründung der Initiative gekommen ist und wie sich das Projekt entwickelt hat. Obwohl Gabriele Weber schon lange nicht mehr im Projekt mitarbeitet, hat sie weiterhin Kontakt zu Julia Pankratyeva und fühlt sich dem Verein Impuls e. V. noch immer verbunden.
-
Zuerst möchte ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen und zu erzählen, wie alles begann
Weber: Die Anfänge des Projekts liegen in den 1990-er Jahren, also 97/98 und gehen zurück auf die Initiative der damaligen Leiterin des Kulturamts, Dr. Dorothea Kolland, die erkannt hatte, dass es aufgrund der hohen Zahl von Aussiedler*innen, einen großen Integrationsbedarf gab. Schon wegen der sprachlichen Barriere blieben diese Menschen zuerst einmal unter sich. Es entstand die Idee, im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, das ja bereits bestand und an das Kulturamt angeschlossen war, ein Integrationsprojekt aufzubauen. Und zwar Integration durch kulturelle Veranstaltungen und kulturelles Zusammensein. Im weitesten Sinne. Das schloss auch Sprachförderung mit ein, aber die Kultur stand im Vordergrund. Die erste Zielgruppe waren die Aussiedler*innen. Einige sprachen auch Deutsch, die meisten sprachen aber Russisch. Und dann kam noch eine andere russischsprachige Gruppe hinzu – die Gruppe der Kontingentflüchtlinge. Das waren jüdische Emigrant*innen aus der ehemaligen Sowjetunion, die in Deutschland ein Bleiberecht bekamen.
Pankratyeva: Es kamen auch Menschen aus Tschechien und aus Polen. Die größte Gruppe waren aber die Aussiedler*innen.
-
Wie kann ich mir das vorstellen? Haben sie ein Kulturprogramm angeboten oder ging es auch um Beratung?
Pankratyeva: Begonnen hat es mit einer Anzeige in einer lokalen Zeitung – der Ankündigung eines Treffens für Aussiedler*innen. Wir waren damals etwa 20 Personen. Du (an Weber gerichtet) hast bei diesem Treffen gefragt, welche Art Angebot sich die Teilnehmer*innen wünschen. Die Wünsche wurden alle auf einem Plakat festgehalten. Einige haben sich Exkursionen gewünscht und eine Teilnehmerin hat sich sofort für einen Deutschkurs ausgesprochen (an Gabriele Weber gewandt) – sehr zu Deiner Freude.
Weber: (Lachen) Ja. Ich bin nämlich Deutschlehrerin.
Pankratyeva: Das muss unbedingt zusammengehen – Deutschkurse und Kulturangebot.
Weber: Ich habe mit dem Projekt angefangen. Frau Dr. Kolland hatte mich angefragt, weil sie wusste, dass ich eine Verbindung zu Osteuropa hatte. Also eigentlich Polen. Und dann kam Julia (Pankratyeva) dazu. Auch über das Kulturamt. Ich bin in Westdeutschland geboren und Julia in der Ukraine. Wir haben uns hier getroffen und festgestellt, dass wir die gleiche Zielsetzung und die gleichen Vorstellungen davon haben, was Integration bedeutet und wie man das umsetzen sollte. Wir waren von Anfang an auf einer Welle und das war auch ganz wichtig. Und dann haben wir erst mal versucht, uns bekannt zu machen. Zuerst mit niedrigschwelligen Angeboten, zum Beispiel Treffpunkten wie dem Samowarabend, um ins Gespräch zu kommen und sehr bald gab es Deutschkurse und Exkursionen. Am Anfang war es schwierig, die Menschen aus ihren Wohnungen zu locken.
Pankratyeva: Einige haben zum ersten Mal eine U-Bahn gesehen und hatten Schwierigkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Treffpunkt war deshalb immer der U-Bahnhof Lipschitzallee. Und dann sind wir zusammen irgendwo hin gegangen.
Weber: Die Sprachbarriere war sehr groß und viele hatten Angst, überhaupt in den öffentlichen Raum zu gehen. Viele Männer waren noch unsicherer als die Frauen. Wir hatten einen viel höheren Frauenanteil. Es waren so um die 70 % – 80 % Frauen. Wir haben dann Deutschkurse und Exkursionen angeboten und es gab regelmäßige Gesprächsabende (die Samowarabende). Im Laufe der Zeit wurde das Angebot in Zusammenarbeit mit der Alice Salomon Hochschule (ASH – Hochschule für Soziale Arbeit, Gesundheit und Erziehung) zum Erzählcafé ausgeweitet. Wir haben auch viele Veranstaltungen auswärts gemacht. Zum Beispiel Betriebsbesichtigungen, Städtereisen nach Weimar, nach Prag und natürlich Berlin-Erkundungen. Es gab musikalische und politische Abende und gestalterische Angebote.
Pankratyeva: Übrigens, während des Bestehens von ImPULS haben wir mehr als 40 Städte in Deutschland besucht.
Weber: Von Anfang an war es uns wichtig, dass meistens Deutsch gesprochen wurde.
Pankratyeva: Alle unsere Spaziergänge und Reisen führten und führen wir auf Deutsch durch. Später als wir schon der „Interkulturelle Treffpunkt“ waren, habe ich nie Flyer in anderen Sprachen gemacht. Es war mir wichtig, dass die Leute so viel Deutsch konnten, dass sie selber kurze Information lesen konnten. Die Infos waren deshalb einfach gehalten, nach dem Schema „was und wo“. Später hat uns die Stadtteilzeitung Walter sehr geholfen. In den Deutschkursen haben wir sie immer zusammen gelesen. Das war unser Anliegen, dass die Leute zumindest soviel Deutsch konnten, um mit Nachbarn oder dem Hausmeister klarzukommen.
Weber: Ein großer Schwerpunkt war auch der Kontakt mit den „Alteingesessenen“. Das war natürlich am Anfang schwierig, aber wir haben dann Veranstaltungen entwickelt, um die Menschen zusammenzubringen. Im Erzählcafé kamen dann die Student*innen von der ASH, Aussiedler*innen und Alteingesessene zusammen, um sich über ihre Erfahrungen und Hintergründe auszutauschen. Sie konnten erzählen, was sie erlebt hatten und sich kennenlernen.
Pankratyeva: Es gab auch einen Kontakt mit dem Verein Dritter Frühling. Wir haben Workshops zusammen gemacht, zum Beispiel einen Theaterworkshop mit Einheimischen und Aussiedler*innen und später haben wir auch eine Wand im Gemeinschaftshaus mit Graffity gestaltet. Das war auch eine gemischte Gruppe aus Einheimischen und Aussiedler*innen.
Mit der Zeit hat es sich so entwickelt, dass viele „Ur“ Anwohner*innen Interesse zeigten und so wurde eine Handarbeitsgruppe gegründet, zu der auch Vertreter*innen aus Deutschland, Polen, Kasachstan, Iran, Russland und Spanien gehörten.
-
Das hat also gut funktioniert?
Weber: Ja, aber das war das Mühevollste. Das muss man sagen. Es ging aber eben darum, dass die Gruppen nicht untereinander blieben. Migrant*innen und Einheimische sollten möglichst schnell miteinander in Kontakt kommen.
-
Da habe ich noch eine Frage. Wie passt die alte Dame (siehe Foto) von vorhin ins Bild?
Weber: Das ist eine Aussiedlerin. Klara konnte von Anfang an schon ganz gut Deutsch. Sie ist von ersten Stunde an mit dabei.
Pankratyeva: Wir haben uns zufällig im Bus kennengelernt und ich habe sie eingeladen, vorbeizukommen. Sie ist dann der Einladung gefolgt und hat noch andere mitgebracht.
-
Was waren das sonst noch für Angebote, die eine möglichst breite Gruppe ansprechen sollten?
Weber: Wir haben zum Beispiel Podiumsdiskussionen veranstaltet. Wir hatten Kontakte zu Dritten, wie der Evangelischen Kirchengemeinde Wutzkyallee. Die haben Beratung für Aussiedler*innen angeboten und dort haben wir zum Beispiel auch politische Podiumsveranstaltungen organisiert, an denen auch Politiker*innen teilgenommen haben.
Pankratyeva: Und nicht zu vergessen Gropiusstadt 2000. Das war ein großes Projekt mit Ausstellung, Podiumsdiskussionen und Workshops.
Weber: Innerhalb von drei Jahren wuchs das Interesse rasant an und wir brauchten dann zu den Frühlings- oder Weihnachtsveranstaltungen schon den Großen Saal und mussten noch Leute abweisen. Ich musste das Projekt dann leider verlassen, weil man mir keine Perspektive bieten konnte. Ich hatte nochmal die Chance, als Lehrerin an eine Berufsschule zu gehen und bin, allerdings schweren Herzens, gegangen.
Pankratyeva: Und ich bin allein zurückgeblieben.
Weber: Ja leider. Der Bezirk hat viel für den Ort getan und vieles ermöglicht. Aber es gab keine feste Anstellung, für Julia bis heute nicht.
-
Ich vermute, die Aufgaben sind nicht gerade weniger geworden. Ich kann mir vorstellen, dass der Interkulturelle Treffpunkt im Augenblick wieder ein wichtiger Anlaufpunkt ist, weil seit einem Jahr viele Geflüchtete aus der Ukraine nach Berlin kommen.
Pankratyeva: Seit 2007 waren hier viele Migrant*innen, darunter viele aus der Türkei, dem arabischen Raum. Es war offensichtlich, dass man allen ein Angebot machen musste. Also einen im wahrsten Sinne „interkulturellen“ Treffpunkt schaffen. 2014 kamen dann im Zuge des andauernden Bürgerkriegs in Syrien nochmal sehr viele Geflüchtete. Auch aus dem Iran und dem Irak. Wir haben bei der Wohnungssuche geholfen, bei der Suche nach Betreuungsplätzen für Kinder und allgemeine Beratung durchgeführt. Ja, und nachdem sich die Lage deutlich beruhigt hatte, kommen jetzt Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten und stellen uns vor neue Herausforderungen. Wir waren von Anfang an involviert. Ich habe im Rathaus Beratungen durchgeführt. Diese Menschen hatten überhaupt keine Orientierung, da war das Rathaus der geeignete Ort, um einen Kontakt herzustellen. Ich habe im Sozialamt geholfen, gedolmetscht. Und jetzt beginnt die Geschichte mit den neuen Geflüchteten sozusagen wieder von vorne.
-
Und wer unterstützt Impuls e. V.?
Pankratyeva: Seit vielen Jahren unterstützt uns das Bezirksamt Neukölln / Kulturamt und das Quartiersmanagement in der Gropiusstadt. Dafür spreche ich meinen großen Dank aus. Ohne diese Unterstützung hätten wir nicht weitermachen können. Über das Kulturnetzwerk Neukölln e. V. kommen die vielen Mitarbeiter*innen, ohne die der Betrieb nicht laufen würde. Auch dafür bin ich dankbar. Die jeweiligen Leiter*innen des Gemeinschaftshauses haben uns auch sehr unterstützt. Die neue Leiterin, Anna Maier, ist sehr zugewandt und engagiert. Ich denke, sie ist ein Gewinn für das Gemeinschaftshaus und die Zusammenarbeit wird gut.
-
Wir könnten uns noch lange unterhalten, aber ich fürchte, wir müssen langsam zum Ende kommen. Daher meine Frage: Gibt es etwas, das sie noch gerne mit den Leser*innen teilen möchten?
Pankratyeva: Ich möchte noch etwas unbedingt erwähnen. Wir haben 2008 mit dem Projekt Begegnung der Kulturen angefangen. Das ist mittlerweile eine sehr große Veranstaltung. Also damals war es nur eine kleine Veranstaltung. Mittlerweile präsentieren sich bis zu 15 Kulturen an einem Abend. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe und mit viel Arbeit verbunden, aber ich gehe mit dem Gefühl nachhause, etwas Wichtiges geschafft zu haben. Wir bringen nämlich Menschen zusammen, aus Kulturen, die weit von einander sind und sogar Konflikte miteinander haben. Und alle arbeiten ganz friedlich zusammen. Es ist wirklich nicht einfach, diese harmonische Atmosphäre zu schaffen, in der am Ende zum Beispiel Türk*innen zu russischer oder griechischer Musik tanzen und umgekehrt. Und jetzt geht es darum, zwischen Ukrainer*innen und Russ*innen eine entspannte Atmosphäre zu schaffen.
Weber: Die politischen Hintergründe stehen bei der Veranstaltung Begegnung der Kulturen mal nicht im Vordergrund. Da gehört viel Überwindung dazu. Bei dieser Art Arbeit geht es um die zwischenmenschliche Begegnung. In den ersten drei Jahren habe ich das noch begleitet, aber seitdem macht Julia das ganz alleine. Mit der Zeit hat sich der Kreis der teilnehmenden Kulturen auch sehr erweitert.
Pankratyeva: Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese Art der Begegnung sozusagen der erste Stein ist, auf dem man aufbauen kann.
-
Nochmal nachgefragt. Sprechen wir über die Vergangenheit oder findet die Begegnung der Kulturen noch immer statt?
Pankratyeva: Die Veranstaltung findet seit 15 Jahren statt und läuft auch immer noch. Und letzten September haben wir daraus auf dem Lipschitzplatz eine Open Air Veranstaltung gemacht, weil der Saal immer voll ist und immer mehr Menschen kommen als Plätze vorhanden sind. Es haben sich sogar Menschen schriftlich darüber beschwert, dass sie nicht reinkamen, deshalb habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass das möglich wurde.
Weber (an Pankratyeva gerichtet): Und was wünschst Du Dir für die Zukunft?
Pankratyeva: Ich bin jetzt kurz vor der Rente und werde in diesem Jahr aufhören. Ich wünsche mir, dass diese wichtige Arbeit auch in Zukunft fortgesetzt wird. Ich möchte, dass das Gemeinschaftshaus für Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte ein echtes Zuhause ist: interkulturell und generationsübergreifend.
- Das wird vermutlich nicht einfach, loszulassen?
Pankratyeva: Ich habe in meinem Leben ganz unterschiedliche Sachen gemacht und mal sehen, was danach kommt. Es ist einerseits schwierig, aber auch interessant.
- Ich bedanke mich für das Gespräche und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Bleibt zu hoffen, dass sich eine ebenso engagierte Nachfolger*in findet.